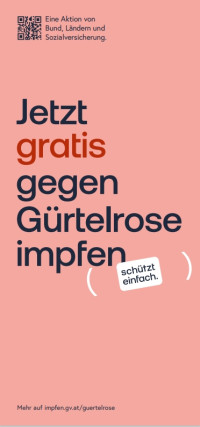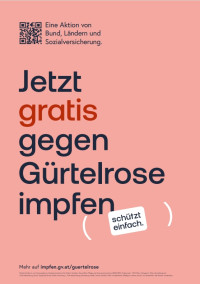Gürtelrose (Herpes Zoster)
Gürtelrose, auch Herpes Zoster genannt, ist eine schmerzhafte Erkrankung, die durch das Varizella-Zoster-Virus verursacht wird. Dieses Virus bleibt nach Feuchtblattern (Varizellen, Windpocken) lebenslang im Körper und kann mit fortschreitendem Alter oder bei Immunschwäche reaktiviert werden. Bei Gürtelrose kommt es typischerweise im Versorgungsbereich einzelner Nerven zu brennenden, stechenden Schmerzen und streifenförmiger Bläschenbildung (daher der Name „Gürtelrose“).
Mehr erfahren
Der Erreger der Gürtelrose, das Varizella-Zoster-Virus, ist derselbe Erreger, der auch Feuchtblattern (Varizellen, Windpocken) hervorruft. Meistens werden die Feuchtblattern bereits in der Kindheit durchgemacht, sofern keine Impfung erfolgt ist. Nach der Erkrankung verbleibt das Virus lebenslang im Körper in bestimmten Nervenzellen. Wenn das Immunsystem geschwächt ist, kommt es nach Jahren oder Jahrzehnten zu einer Reaktivierung des Virus, und somit zum Ausbruch der Gürtelrose.
Gürtelrose betrifft ca. 30 % aller Personen zumindest einmal im Leben. Mit zunehmenden Alter kommt es meist zu einer Abnahme der Immunabwehr, die die im Nervensystem befindlichen Viren in Schach halten, und die Krankheit kann ausbrechen. 50 % der Erkrankungen betreffen Personen älter als 50 Jahre.
Insbesondere immungeschwächte Personen und Personen mit anderen schweren Grunderkrankungen haben ein erhöhtes Risiko, an Gürtelrose zu erkranken und an möglichen Krankheitsfolgen zu leiden, wie zum Beispiel an langdauernden, starken, schwer behandelbaren Nervenschmerzen im betroffenen Bereich.
Das Varizella-Zoster-Virus kommt weltweit vor und ist sehr ansteckend.
Bei Gürtelrose kommt es typischerweise im Versorgungsbereich einzelner Nerven zu brennenden, stechenden Schmerzen und streifenförmiger Bläschenbildung (daher der Name „Gürtelrose“). In vielen Fällen heilt die Krankheit ohne Probleme aus. Manchmal können auch teils schwere Krankheitsfolgen auftreten.
Mögliche Krankheitsfolgen:
Langdauernde, starke, schwer behandelbare Nervenschmerzen im betroffenen Bereich („postherpetische Neuralgie“). Diese Schmerzen kommen mit zunehmendem Alter häufiger vor (50 % bei den über 70-Jährigen).
Anhaltender, unangenehmer Juckreiz der Haut im betroffenen Bereich
Gürtelrose im Bereich der Augen, die unbehandelt zur Erblindung führen kann
Gehirnentzündung
Erhöhtes Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall
Gürtelrose-Impfung
Empfohlen wird die Impfung für alle ab 60 Jahren und für Personen ab 18 Jahren mit erhöhtem Risiko für eine Erkrankung und mögliche Krankheitsfolgen. Eine Wirksamkeit der Impfung für mindestens 11 Jahre wurde nachgewiesen.
Die Gürtelrose-Impfung ist auch bei Personen mit erhöhtem Erkrankungsrisiko ab 18 Jahren empfohlen.
Ein erhöhtes Risiko für Gürtelrose und mögliche Krankheitsfolgen haben Personen ab 60 Jahren, immungeschwächte Personen und mit chronischen/chronisch-entzündlichen Erkrankungen, wie z.B. Autoimmun-, Krebs-, Atemwegs-, Herzkreislauf-, Nieren-, Darm- oder Stoffwechselerkrankungen.
Ihre Ärztin oder Ihr Arzt beraten Sie ausführlich zu den für Sie persönlich empfohlenen Impfungen.
Im öffentlichen Impfprogramm von Bund, Ländern und Sozialversicherung ist die Gürtelrose-Impfung aus dem Impfprogramm für alle ab 60 Jahren und bestimmte Personen ab 18 Jahren mit erhöhtem Risiko für eine Erkrankung und mögliche Krankheitsfolgen an teilnehmenden Einrichtungen gratis.
Der Impfstoff aus dem Impfprogramm ist direkt bei den impfenden Einrichtungen verfügbar und kann von zu impfenden Personen nicht über die Apotheke bezogen werden. Eine Rückerstattung von bereits privat bezahltem Impfstoff oder Kosten der Verabreichung ist nicht möglich und nicht vorgesehen. Der Impfstoff kann also nicht auf eigene Kosten in der Apotheke gekauft und die Rechnung dann zur Rückerstattung eingereicht werden.
Die Gürtelrose-Impfung aus dem öffentlichen Impfprogramm erhält man:
- In teilnehmenden Arztpraxen (sowohl bei Kassen- als auch Wahlärzt:innen), Einrichtungen und Betrieben
- In einigen Bundesländern auch in Einrichtungen der Bezirksverwaltungsbehörden und Magistrate (z.B. Gesundheitsämter)
Der Impfstoff wird vor Ort an der impfenden Einrichtung verfügbar sein.
Impfangebote in Ihrer Nähe
Zur Suche nach impfenden Einrichtungen bzw. Ärztinnen und Ärzten
→
Fragen und Antworten für Bürger:innen
→
Fragen und Antworten für Ärztinnen/Ärzte und impfende Einrichtungen
→
Fragen und Antworten für Kranken-, Kur- und Rehaanstalten, Alten- und Pflegeheime (APH) und andere Betreuungseinrichtungen
→
Fragen und Antworten für Betriebe
→
Weiterführende Informationen
Downloads zur Gürtelrose-Impfung
Hier finden Sie Materialien zur Gürtelrose-Impfung als Download im pdf-Format. Im Broschürenservice des BMASGPK können Sie eine Auswahl der Materialien in gedruckter Form bestellen.
Die Sicherheit und Wirksamkeit zugelassener Impfstoffe wird durch das bewährte Arzneimittelkontrollsystem der Behörden wie bei allen Arzneimitteln streng überwacht.
Prinzipiell kann jede Impfung Impfreaktionen oder Nebenwirkungen verursachen. Bitte sprechen Sie über Wirkung, Risiken und Nebenwirkungen mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt bzw. Ihrer Apothekerin oder Ihrem Apotheker.
Informationen zu Nebenwirkungen finden Sie in der Gebrauchsinformation des jeweiligen Impfstoffes.
Für Gesundheitsberufe besteht in Österreich eine gesetzliche Meldepflicht für vermutete Nebenwirkungen. Vermutete Nebenwirkungen können außerdem Betroffene selbst, sowie deren Angehörige melden.